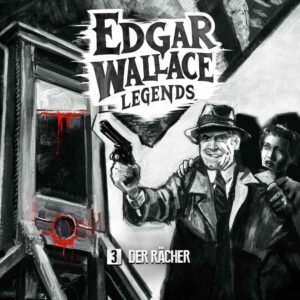
Ein Klassiker in neuer Form
Edgar Wallace gehört zu den Autoren, die im deutschsprachigen Raum einen eigentümlichen Doppelstatus haben: literarischer Krimi-Pionier und zugleich Pop-Phänomen. Kaum ein Name steht so verlässlich für nebelverhangene Straßen, maskierte Rächergestalten, abruptes Lachen aus dem Off und die Frage, wem man in feinster Gesellschaft noch trauen kann. Mit Edgar Wallace Legends – Der Rächer nimmt sich Holysoft einen Stoff vor, der in Deutschland seit Jahrzehnten mitschwingt: das Motiv des selbsternannten Strafengels, der den Rechtsstaat durch eine grausame Paralleljustiz zu ergänzen sucht. Die Reihe Legends verfolgt das Ziel, ikonische Stoffe mit zeitgemäßer Hörspiellästhetik zu verbinden – mit dichtem Sounddesign, klarer Figurenführung und einem Tempo, das sowohl Kenner alter Wallace-Adaptionen als auch jüngere Hörspielfans abholen soll.
Der Rächer ist innerhalb der Reihe eine jener Folgen, die sehr gut zeigen, warum Wallace so haltbar ist. Das Setting wirkt klassisch britisch, die Milieus sind delikat und sozial vielschichtig – vom Filmset über mondäne Salons bis zu Orten, in denen man auch am helllichten Tag lieber nicht gesehen wird. Der Stoff lebt von seiner moralischen Spannung: Was passiert, wenn jemand für sich beansprucht, jene zu richten, die dem System entgleiten? Und was macht das mit den Menschen, die – bewusst oder unbewusst – in diese Spirale geraten?
Wallace-Tradition und die Logik des Rächer-Motivs
Wallace arbeitet oft mit klaren Reizwörtern: Erbschaften, Erpressung, Doppelbödigkeiten, falsche Identitäten und Institutionen, die nicht so handeln, wie man es sich wünschen würde. Das Rächer-Motiv gehört dabei zu den archetypischen Bausteinen des klassischen Thrillers: Eine Figur agiert außerhalb der Rechtsordnung, um vermeintlich Gerechtigkeit herzustellen, und setzt dadurch ein System von Angst, Öffentlichkeit und Nachahmung in Gang. In Der Rächer wird diese Dynamik auf interessante Weise mit der Welt des Films gekoppelt – ein Milieu, in dem Inszenierung, Reputation und Öffentlichkeit ohnehin die Währung sind. Das Hörspiel nutzt diese Kopplung, um Wirkungen zu erzeugen, die über das unmittelbare Verbrechen hinausgehen: Gerüchte werden zum Brandbeschleuniger, und der Rächer wird vom Täter zur Idee – zu einer Figur, die selbst dann in Köpfen spukt, wenn sie gerade gar nicht im Raum ist.
Holysofts Legend-Ansatz positioniert den Stoff zwischen Nostalgie und Moderne. Einerseits klingen in der Dramaturgie und der Musiksprache Erinnerungen an die großen Wallace-Wellen der deutschen Popkultur an. Andererseits ist das Sounddesign heutiger Hörspiele schlicht präziser, detailreicher, konsequenter abgemischt. Schritte haben Richtung, Räume haben Tiefe, Außen und Innen sind sauber getrennt, die Mischung lässt Dialoge atmen, ohne auf Wucht zu verzichten, wenn die Guillotine als Symbol und Geräuschmetapher in den Vordergrund rückt. So bekommt die alte Geschichte eine neue Haptik.

🔞 Hörspiele für Erwachsene
Atmosphärisch, düster, fesselnd – hier findest du packende Hörspiele speziell für erwachsene Hörerinnen und Hörer.
Nichts für schwache Nerven!Zwischen Filmkulisse und Ermittlerblick
Im Zentrum steht die Ermittlungsfigur Mike Brixan, die – typisch Wallace – einerseits professionell, andererseits mit einem feinen Gespür für soziale Unterströmungen arbeitet. Die Ausgangslage: Jemand bringt Kriminelle unter theatralischem Vorzeichen um – nicht als impulsiver Täter, sondern als Exekutor einer selbstgebastelten moralischen Ordnung. Die Botschaften sind perfide gesetzt, die Guillotine fungiert als historisches Zeichen, das Öffentlichkeit herstellt: Es soll gesehen, gehört, gefürchtet werden. Die Ermittlungen führen in Kreise, in denen Status und Schein oft wichtiger sind als Wahrheit. Ein Filmprojekt spielt eine Rolle, weil es nicht nur Kulisse ist, sondern Spiegel – Inszenierung im Wortsinne. Wo hört Show auf, wo beginnt Verbrechen? Und wie verändert die Tatsache, beobachtet zu werden, das Verhalten der Beteiligten?
Das Hörspiel erzählt diese Fragen in zügigen Szenen, die selten länger verweilen, als es der Spannungsbogen verlangt. Gleichzeitig lässt die Inszenierung Nebenfiguren kurz aufblitzen: Sticheleien am Rand, abrupte Wechsel im Tonfall, Nuancen in der Sprechweise. Das schafft jene Atmosphäre, die aus einem bloßen Fall eine Wallace-Welt macht.
Archetypen mit Kanten
Mike Brixan agiert als ordnendes Prinzip: Er beobachtet, rekapituliert, zieht Linien zwischen Ereignissen, die andere gern als Zufälle abtun. Er ist kein kalter Rechner, aber jemand, der Scheinbewegungen erkennt und Nebel als Nebel benennt. Helen Leamington fungiert als emotionaler Resonanzkörper der Geschichte, ohne zur bloßen Projektionsfläche zu verkommen. Sie bringt Perspektiven hinein, die jenseits polizeilicher Logik liegen: Sorge, Irritation, eine Mischung aus Faszination und Unbehagen gegenüber dem Spektakel, das die Morde begleiten. Weitere Figuren – ob Produzenten, Aristokraten, professionelle Beobachter oder halbseidene Kontakte – erweitern das Parkett. Sie sind markiert, aber nicht karikiert; man spürt, dass hinter der Fassade Raum für Motivationen ist, die erst im Laufe der Handlung Kontur gewinnen.
Das Hörspiel nutzt klassische Archetypen – der kühle Ermittler, die aufrechte Verbündete, die ambivalente Elite, der moralische Demagoge im Schatten – und verpasst ihnen dank Sprechleistung, Timing und Geräuschregie genug Profil, um nicht in reine Abziehbilder zu kippen. Gerade in Dialogen, in denen zwischen Ironie und Ernst nur eine halbe Silbe liegt, zeigt die Produktion, wie sehr Sprachrhythmus über Glaubwürdigkeit entscheidet.
Präzises Sounddesign statt Effekthascherei
Die Atmosphäre entsteht aus kontrollierter Zurückhaltung: kein Bombast, sondern ein präzises Sounddesign, das Räume, Distanzen und Blickwechsel hörbar macht. Treppenhäuser klingen schmal und hart, Salons tragen weichen Nachhall, Außenatmo bleibt luftig, ohne die Stimmen zu überdecken – so bekommt jeder Ort seine Signatur. Die Mischung hält Dialoge konsequent vorn; Zischlaute sind gezähmt, tiefe Anteile geben Körper, ohne zu dröhnen. Geräusche wirken nie wie Konserven, sondern wie konkrete Quellen im Raum: das kurze Metallanschlagen, ein bestimmtes Türschnappen, die gedämpfte Mechanik eines alten Apparats. Die Guillotine ist als Klangmarke sparsam gesetzt und dadurch umso eindringlicher – eher ein drohender Schatten, der in der Stille weiterhallt, als ein Dauereffekt. Musik arbeitet mit motivischen Fragmenten statt mit Teppichen: kurze Figuren, die modulieren, aussetzen, wiederkehren und im entscheidenden Moment schweigen. Dieses Spiel mit Dynamik und Leere ist zentral; Stille wird zur Klammer, die Spannung hält, bis ein gezielter Impuls die Szene weiterdreht. Schnitt und Rhythmus vermeiden schematische Taktung: Szenen schließen auf Halbschlägen, Übergänge greifen nahtlos, gelegentlich überlappen Stimmen einen Atemzug lang, um natürliche Unruhe zu setzen, ohne Verständlichkeit zu verlieren. Selbst die Mikrofonführung stützt die Inszenierung – Ein- und Austritte sind als kleine Positionswechsel hörbar, Nahaufnahmen ziehen Intimität, Halbdistanz schafft Distanz. So entsteht ein Klangbild, das modern wirkt, ohne Effekthascherei: aufgeräumt, detailreich, mit ausreichend Headroom für Spitzen, die nicht schmerzen, und genug Feinzeichnung, damit Subtext hörbar bleibt. Kurz: Die Produktion vertraut der Präzision – und genau daraus speist sich die Atmosphäre.
Klassische Krimi-Mechanik mit moderner Temposteuereung
Der Rächer verbindet klassische Krimi-Mechanik – Indizienketten, Perspektivwechsel, Fehlleitungen – mit einem Tempo, das heutigen Hörgewohnheiten entspricht. Szenen beginnen oft in medias res, sparen Exposition und liefern Informationen in bewegten Dialogen. Gleichzeitig gibt es kleine Ruhepunkte, in denen Brixan rekapituliert oder zwei Figuren in einem halblauten Ton Dinge aussprechen, die bisher nur als Andeutungen im Raum lagen. Dadurch entsteht ein Rhythmus aus Vorwärtstreiben und Einordnen. Das ist wichtig, weil der Stoff leicht Gefahr laufen könnte, im Effekt aufzugehen. Stattdessen hält die Inszenierung stets den roten Faden.
Ein markantes Stilmittel ist die Spiegelszene: Das Hörspiel stellt mehrfach Situationen nebeneinander, in denen eine Aussage, ein Blick, ein Geräusch in zwei Kontexten völlig anders wirkt. So wird deutlich, wie sehr Wahrnehmung von Blickrichtung abhängt – ein Leitmotiv bei Wallace, der Figuren gern dieselbe Wahrheit aus verschiedenen Winkeln betrachten lässt.

📱 PWA – Progressive Web App
Nutze die Website wie eine App: auf dem Startbildschirm, schnell geöffnet, mit Offline-Funktion für Inhalte und optionalen Mitteilungen zu Neuerscheinungen.
Jetzt als PWA installierenMoral, Öffentlichkeit, Inszenierung
Im Kern verhandelt „Der Rächer“ drei eng verflochtene Linien: moralische Anmaßung, Öffentlichkeit als Bühne und die Macht der Inszenierung. Das Rächer-Prinzip behauptet, dort Gerechtigkeit herzustellen, wo das System vermeintlich versagt. Diese Selbstermächtigung wirkt verführerisch, weil sie das Versprechen schneller Klarheit gibt, und zugleich zerstörerisch, weil sie Recht in Ritus verwandelt: Die Guillotine steht nicht nur als Tatmittel, sondern als Kultobjekt einer privat definierten Moral. Die Folge zeigt, wie dünn die Trennlinie zwischen Gerechtigkeitsempfinden und Straflust ist, wenn ein Einzelner die Maßstäbe bestimmt. Dem gegenüber steht der Rechtsstaat, der um Verfahren ringt, Zweifel aushält und langsamer wirkt – eine Unwucht, die der Rächer kalkuliert, indem er seine Urteile so präsentiert, dass sie im Echo der Empörung größer klingen als jede juristische Nuance.
Öffentlichkeit wird dabei zum Katalysator. Weil ein Filmprojekt den Rahmen bildet, verschmilzt die Tat mit der Logik der Bühne: Kameras, Licht, markante Geräusche – alles formt einen Auftritt. Der Rächer operiert nicht im Dunkel, er choreografiert Wahrnehmung; seine Verbrechen sind Aufführungen, die Zuschauer brauchen. Das Hörspiel spiegelt das, indem es Dialoge, Räume und Geräuschmarken so setzt, dass auch der Hörer zum Zuschauer einer Inszenierung wird. Gerüchte, Schlagzeilen, geflüsterte Halbsätze bauen einen Resonanzraum, in dem die Figur des Rächers schon dann wirkt, wenn er gar nicht handelt – eine Idee, die zirkuliert und Verhalten verändert. So entsteht eine Feedback-Schleife: Je größer die öffentliche Erregung, desto mächtiger die Symbolik, desto anschlussfähiger die Pose der scheinbar kompromisslosen Gerechtigkeit.
Inszenierung ist schließlich nicht nur die Methode des Täters, sondern das Grundmotiv der gesamten Welt. Rollen, Titel, Kostüme – im Salon wie am Set – liefern Autoritätssignale, die missbraucht werden können. „Der Rächer“ entfaltet ein Spiel um Masken: Wer spricht als wer, mit welchem Ziel, und wie verschiebt sich Bedeutung, wenn derselbe Satz in einem anderen Rahmen fällt? Die Folge nutzt Spiegelszenen, um diesen Effekt hörbar zu machen: Ein Geräusch, ein Wort, ein Blickwechsel trägt je nach Kontext andere Last. Dadurch rückt ein zweites Thema nach vorn: Vertrauen. In einer Umgebung, in der alles Bühne sein kann, verliert das Offene an Selbstverständlichkeit; Vertrauen muss performt und geprüft werden. Moral, Öffentlichkeit und Inszenierung greifen ineinander wie Zahnräder: Die private Moral braucht die Bühne, die Bühne verstärkt die Pose, die Pose korrumpiert das Vertrauen – und genau daraus bezieht der Fall seine Spannung.
Tonalität, Timing, Dialogchemie
Die Qualität eines Wallace-Hörspiels steht und fällt mit Timing. Pausen sind hier keine Lücken, sondern dramaturgische Zäsuren. Der Rächer nutzt Mikro-Pausen, um Verdacht, Unsicherheit oder eine kommende Wendung anzukündigen – minimalistisch, aber wirksam. Die Chemie zwischen Ermittlerfigur und Gegenübern trägt die Dialoge. Man spürt, wann jemand ausweicht, wann ein Satz zu glatt ist, wann eine Stimme kurz bricht. Diese mikroakustischen Marker liefern das, was Bilder in Filmen leisten: den nicht ausgesprochenen Subtext.
Zudem beweist die Regie ein gutes Gespür für Registerwechsel. Wallace lebt von Figuren, die innerhalb weniger Sekunden den Ton ändern – vom höflichen Plaudern zum eiskalten Kalkül. Wenn das zu hart gefahren wird, kippt es ins Overacting. Hier bleibt es kontrolliert: genug Kante, um Spannung zu erzeugen, ohne ins Theaterhafte zu rutschen.
Handwerkliche Details – warum die Folge läuft
„Der Rächer“ läuft, weil die Produktion konsequent von der Szeneaufgabe her denkt und jede Einstellung ein klares Ziel hat: Informationen wandern nicht über erklärende Monologe, sondern über Handlung, Blickwechsel und subtiles Wording. Die Regie baut eine saubere Set-up/Pay-off-Kette, in der kleine akustische Marker – das Anschlagen eines Metallteils, das spezielle Türschnappen eines bestimmten Ortes, ein wiederkehrender Halbsatz – später Bedeutung tragen. Das Sounddesign trennt Räume präzise, ohne steril zu wirken: Außenatmos entfaltet Breite, Innenräume bleiben trocken genug, damit Dialoge vorn stehen. Man hört, dass die Mischung Dialogfrequenzen freischneidet; Zischlaute sind gebändigt, die Tiefen geben Körper, ohne die Effekte zu verschlucken. Musik arbeitet mit Leitmotiven statt mit Dauerteppich: kurze Figuren, die variieren, brechen oder im entscheidenden Moment aussetzen, sodass Stille selbst zur Spannung wird. Diese kontrollierte Dynamik ist zentral – die Folge atmet, zieht an, lässt los und greift dann wieder zu. Auch die Mikrofonführung ist durchdacht: Entfernungen, Ein- und Austritte, Drehungen am Punkt vermitteln Blocking, ohne dass man es sieht. Wo Dialoge überlappen, tut es die Mischung bewusst und kurz, um natürliche Unruhe zu setzen, nicht um Information zu verlieren. Geräuschkulissen stammen hörbar aus konkreten Quellen; die Guillotine funktioniert nicht als plumpe Effektmaschine, sondern als seltene, punktgenau platzierte Klangsignatur, deren Echo im Kopf weiterarbeitet. Schnitt und Rhythmus vermeiden symmetrische Taktung: Szenen schließen gern auf Halbbeats, die nächste startet knapp versetzt – ein Trick, der Vortrieb erzeugt, ohne künstlichen Stress. Schließlich hält die Dramaturgie die Perspektive diszipliniert: Wer was weiß, ist stets nachvollziehbar; falsche Fährten sind fair gelegt, weil sie aus Figurenlogik, nicht aus Willkür entstehen. Dieses Zusammenspiel aus Szenenökonomie, motivischer Klarheit, intelligenter Dynamik und dialogfreundlicher Abmischung macht die Folge robust – sie bleibt auch beim zweiten Hören tragfähig, weil man unter der Oberfläche ein fein verzahntes, handwerklich sauberes Räderwerk entdeckt.
Tradition vs. Gegenwart
Wer die klassische deutsche Wallace-Rezeption kennt – ob als Buch, Film oder ältere Hörspielbearbeitungen –, wird in Der Rächer viele vertraute Marker erkennen: das Ermitteln im feinen Milieu, die Maschinerie aus Briefen, Botschaften, Maskerade, die Bühne der Öffentlichkeit. Holysoft übersetzt das in eine Gegenwartsproduktion, die nicht modern tut, indem sie alles ironisiert, sondern modern ist, weil sie präzise arbeitet. Das ist, bei einem so oft adaptierten Stoff, die klügste Entscheidung. Statt lauter Modernisierungs-Gesten bekommt man saubere Dramaturgie, starke Klangbilder und eine Regie, die dem Stoff vertraut, ohne devot zu sein.
Für wen eignet sich die Folge?
Die Folge eignet sich besonders für Hörer, die klassische Krimi-Mechanik mit moderner Produktionsqualität schätzen: Wallace-Fans finden hier eine souveräne Neuinterpretation, die vertraute Motive respektiert und klanglich frisch erzählt. Wer Krimis wegen moralischer Spannung und sauberer Ermittlungsdramaturgie hört, bekommt eine kontrollierte, stringente Inszenierung ohne Effekthascherei, die über Dialogchemie und Setups arbeitet. Für Einsteiger ist „Der Rächer“ ein guter Zugangspunkt, weil der Fall in sich geschlossen ist und Figuren sowie Milieu klar konturiert bleiben, ohne viel Vorwissen zu verlangen. Hörer mit Faible für Sounddesign kommen auf ihre Kosten, denn Raumtiefe, Geräuschdramaturgie und Musik sind präzise abgestimmt und tragen die Spannung, ohne Dialoge zu übertönen. Wer Hörspiele gern zweimal hört, um Subtexte, wiederkehrende Motive und feine ironische Brechungen zu entdecken, profitiert von der hohen Wiederspielbarkeit; die Folge belohnt aufmerksames Hören mit eleganten Payoffs. Weniger geeignet ist sie für alle, die permanente Eskalation, extreme Emotionen oder wilde Meta-Spielereien erwarten: „Der Rächer“ spielt die Karte der kühlen Präzision und setzt auf Atmosphäre, gemessenes Tempo und eine markante, aber kontrollierte Symbolik. Genau deshalb ist die Produktion ideal für Hörer, die stilvolle Spannung, klare Linien und eine konzentrierte Erzählhaltung bevorzugen.

📱 WhatsApp-Kanal
Immer auf dem Laufenden – direkt in deinem WhatsApp! Erhalte exklusive Hörspiel-Tipps, Neuerscheinungen, Hintergrundinfos und Highlights, bevor sie alle anderen sehen.
Jetzt dem WhatsApp-Kanal beitretenMögliche Kritikpunkte
Einige Hörer könnten das klassische Rächer-Setup als zu erwartbar empfinden: Bestimmte Wendungen zeichnen sich früh ab, weil der Stoff bewusst in den vertrauten Wallace-Bahnen bleibt. Die Inszenierung setzt zudem eher auf kühle Eleganz als auf emotionale Eskalation; wer starke Gefühlsausbrüche oder drastische Ausschläge sucht, wird die kontrollierte Tonlage stellenweise als distanziert wahrnehmen. Die Symbolik rund um die Guillotine ist wirkungsvoll, kann aber als allzu deutlich gelesen werden – eine Chiffre, die so präsent ist, dass subtilere Täterhandschriften daneben blass wirken. Der Milieu-Fokus auf Filmset und gehobene Kreise liefert reizvolle Spiegelungen von Öffentlichkeit und Inszenierung, verengt aber die soziale Perspektive; eine stärkere Reibung mit „normalen“ Lebenswelten hätte zusätzliche Erdung gebracht. Schließlich arbeitet die Dramaturgie sehr effizient mit Informationssplittern und Spiegelszenen – das belohnt aufmerksames Hören, kann jedoch bei flüchtiger Aufmerksamkeit wie unterkühlte Exposition wirken. Alles in allem sind das eher Geschmacksfragen als echte Brüche: Die Folge entscheidet sich bewusst für Präzision, kontrolliertes Tempo und eine klar geführte Motivik – wer genau diese Linie mag, wird die genannten Punkte als Stil, nicht als Schwäche lesen.
Stärken
Die Stärken liegen in der kühlen Präzision der Inszenierung: klare Dramaturgie ohne Leerlauf, ein Sounddesign, das Räume, Objektgeräusche und Musik so bündelt, dass Dialoge stets vorn bleiben, und eine konsequent geführte Motivik, in der die Guillotine als akustische und symbolische Achse wirkt. Die Sprecher liefern sauberes Timing mit feinen Registerwechseln; Pausen werden als dramaturgische Zäsuren genutzt, Subtexte schimmern durch, ohne ausbuchstabiert zu werden. Das Tempo verbindet klassische Krimi-Mechanik mit moderner Szenenökonomie: Information fließt über Handlung und Gespräche, nicht über erklärende Monologe. Die Folge setzt auf Atmosphäre statt Effekthascherei, hält Spannung über Blickwechsel und Spiegelszenen und wahrt dabei eine elegante Distanz, die den Reiz des Rächer-Motivs nicht verheizt. Tradition und Gegenwart greifen sauber ineinander, wodurch „Der Rächer“ sowohl für Wallace-Kenner als auch für Einsteiger funktioniert und beim zweiten Hören durch sorgfältig platzierte Setups und Payoffs zusätzlich gewinnt.
Hörwert & Wiederspielbarkeit
Wallace-Stoffe gewinnen oft beim zweiten Hören, weil man dann nicht nur der Frage Wer war es? folgt, sondern den Mikrobewegungen – Tonlagen, Atemschnapper, Wortwiederholungen, ironische Brechungen. Der Rächer ist genau so gebaut: Beim ersten Durchlauf dominiert Spannung; beim zweiten fällt auf, wie sauber Setups und Payoffs verteilt sind. Man entdeckt kleine Anker, die zuvor wie atmosphärische Dekoration wirkten, und erkennt sie als dramaturgische Markierungen. Für Sammler ist die Folge daher katalogtauglich – ein Titel, den man später erneut aus dem Regal zieht, um nicht nur Nostalgie, sondern Handwerk zu genießen.
Ein souveräner Wallace, der seine eigene Ruhe behält
Edgar Wallace Legends – Der Rächer ist eine souveräne Adaption, die die Kraft der Vorlage ernst nimmt und mit heutigen Mitteln verdichtet. Sie entscheidet sich gegen schrille Modernismen und für Präzision. Das Ergebnis ist ein Hörspiel, das nicht aus dem Materiellen – Blut, Schreie, laute Musik – seine Wirkung zieht, sondern aus Kontrolle: Geräusche, Pausen, Figurenrhythmus. Der Fall selbst ist klassisch, seine Umsetzung wirkt frisch, weil sie ohne Verlegenheit klassisch sein darf. Genau das ist die Stärke: Die Produktion traut dem Genre, dem Stoff und den Hörern zu, dass Klang und Haltung genügen.
Wer eine laute Demontage der Wallace-Tradition erwartet, ist hier falsch. Wer eine stilsichere Neuauflage möchte, die den Reiz des Rächer-Motivs nicht moralisch verkürzt, sondern dramaturgisch auskostet, bekommt eine Folge, die in der Reihe Legends sehr gut markiert, wofür diese Marke stehen kann: Klassik, modern erzählt.
Edgar Wallace Legends – Der Rächer
* Affiliate-Link: Wenn du über diesen Link einkaufst, erhalten wir eine kleine Provision. Für dich ändert sich nichts am Preis.
- Label / Verlag: Holysoft
- Veröffentlicht:
- Genre: Krimi
- Herkunft: Deutschland
Produktion
- Produktion: David Holy
- Skript: Marc Freund
- Regie: Dirk Jürgensen
- Sounddesign: Manuel Georg Strasser
- Dialogschnitt: Manuel Georg Strasser
Sprecher
- Erzählerin – Gisa Bergmann
- Inspektor Mike Brixan – Roman Wolko
- Helen Leamington – Madiha Kelling Bergner
- Sir Gregory Penne – Gunnar Bergmann
- Jack Fisher – Stefan Senf
- Sampson Longvale – Thomas Fitschen
- Stella Mendoza – Cathlen Gawlich
- Harry Fletcher – Nils Andre Brünnig
- Reggie Conolly – Klaus-Peter Grap
- Lawley Voss – Felix Holm
- Francis Elmer – Marc Schülert
Weitere Hörspiele aus dieser Reihe:
Jetzt bist du dran!
Fehlt dir etwas, siehst du etwas anders oder hast du einen Hörspiel-Tipp zum Thema? Schreib es in die Kommentare – so wird der Artikel mit euren Meinungen noch besser.
Kommentar hinzufügen